Artikel in den Kirchenseiten
Die Marktkirche – Zukunftschancen und Zukunftssorgen



Seit Jahren ist die Marktgemeinde bemüht, die besondere Rolle, die ihrer Kirche innerhalb Goslars zukommt, durch ein angemessenes Programm auszufüllen. Zwei Faktoren sind in diesem Zusammenhang bedeutsam: Zum einen ist die Marktkirche eine Touristenkirche. Wer in die Stadt reist, ob mit dem Auto, dem Zug oder dem Reisebus, kommt über eines der beiden Tore der Stadt in Goslar an, über den Bahnhof oder das Areal der Kaiserpfalz. In aller Regel werden die Schritte der Ankommenden dann in Richtung Innenstadt gelenkt – und damit zum Marktplatz, dem Rathaus und der Marktkirche. Der Marktkirche statten jährlich viele Touristen einen Besuch ab.
Der Gästeservice sorgt dafür, dass die Kirche ganztägig offensteht und der Turm, die „Himmelsleiter“, besteigbar ist. Die Kirchenführer und Kirchenführerinnen erläutern Besonderheiten und Geschichte der Kirche.
Damit ist die zweite Besonderheit angesprochen: Die Marktkirche zählt zu denjenigen Kirchen, für die sich der Begriff „Citykirche“ eingebürgert hat. Hier gibt es ein reichhaltiges musikalisches Veranstaltungsangebot, hier hat der Rat der Stadt sein kirchliches Gegenüber, hier finden Vorträge statt, hier gibt es Ausstellungen, sei es aus dem Bereich Kunst oder mit eher informativem Inhalt. Auch durch den Sitz der Propstei an der Marktkirche kommt es zu einer gewissen Bündelung der kirchlichen Aktivitäten. Was im Gemeindeleben vieler Gemeinden auf Grund fehlender Ressourcen nicht möglich ist, kann an der Citykirche seinen Ort haben: Eine Bürgerkanzel, die prominenten Predigern und –predigerinnen aus unterschiedlichen Berufen gewidmet ist, außergewöhnliche musikalische Darbietungen der Goslarer Kantorei, ein Gottesdienst aus Anlass des Schützenfestes, ökumenische Gottesdienste, z. B. zur Eröffnung der neuen Saison von „Brot für die Welt“ und „Misereor“ usw.
All das erfordert allerdings auch einen besonderen personellen und finanziellen Einsatz und Aufwand. Und hier beginnt nun das Problem. Seit etwa zwei Jahren gibt es ein neues Finanzverteilungsgesetz in der Braunschweiger Landeskirche, das im Gegensatz zum früheren Verfahren nicht mehr bedarfsorientiert ist. In Zeiten zurückgehender Mittel soll nur das Geld ausgeschüttet werden, was voraussichtlich zur Verfügung steht. Das klingt vernünftig, sind doch die angemeldeten Bedarfe in der Regel höher. Bei der Neuordnung legte man auf ein möglichst simples Verfahren wert, um Verwaltungskosten einzusparen. Die Gelder werden nach Gemeindegliederzahlen verteilt. Eine Gemeinde mit vielen Gemeindegliedern bekommt also proportional mehr Geld als eine kleine Gemeinde. Hinzu kommt jeweils eine Pauschale von 5.000,- €/Jahr pro dazugehöriger Kirche.
Die „Verlierer“ des Verfahrens standen von vornherein fest: Nämlich diejenigen Gemeinden und Kirchen, die bei relativ wenigen Gemeindegliedern dennoch vergleichsweise große Aufgaben zu stemmen haben. Häufig sind das die „Hauptkirchen“ der Städte im Braunschweiger Land, deren Gemeindebezirk aufgrund der Neugründungen im 20. Jahrhundert klein geworden ist. Teilweise stehen diesen Kirchen andere Finanzierungsquellen zu Verfügung, indem Stiftungen oder Mäzene Unterstützung leisten. Wo dies nicht der Fall ist, gerät die bisher geleistete Arbeit in Gefahr. Für die Marktkirche heißt dies, dass die Zuweisung innerhalb von gut 10 Jahren um mehr als die Hälfte gekürzt wurde bzw. wird. Die Eigeneinnahmen der Gemeinde zum Beispiel aus Spenden, Zuwendungen der Fördervereine oder den Eintrittsgeldern für die Himmelsleiter (Marktkirchenturm) liegen heute höher als die landeskirchliche Zuweisung. Damit ist die Zielgröße, die etwa die hannoversche Landeskirche für das Verhältnis von Eigeneinnahmen und landeskirchlicher Zuweisung ausgibt, nämlich 50 %, bereits überboten. Die Folge der Entwicklung ist, dass der Haushalt nicht mehr ausgeglichen werden kann. Soll hier Abhilfe geschaffen werden, so geht dies nun noch auf zwei Wegen: Entweder durch einen massiven Abbau der Aktivitäten an der Marktkirche oder durch eine Änderung der Zuweisungspolitik. Sparen alleine hilft nicht.
Die Frage nach den Finanzen geht aber über das Pekuniäre hinaus. Letztlich steht die Frage im Raum, auf welche Weise die Kirche in der Gegenwart am besten ihrem Auftrag nachkommen kann. Die ausschließliche Fokussierung auf die Gemeinden führt zu einer zu starken Binnenorientierung. Oft fehlt ihnen die Kraft, über den Kreis der Hochidentifizierten hinaus in die Öffentlichkeit hinein zu wirken. Deshalb gilt es zu schauen, wo auch außerhalb der Gemeinden die „Kommunikation des Evangeliums“ (E. Lange) geschehen kann. Das können Klöster sein, ebenso wie Akademien oder Theologische Zentren, aber auch „Profilgemeinden“ wie eine Jugendkirche. Natürlich kommen auch Urlauber- und Citykirchen in Betracht. Je größer die Vielfalt der Formen ist, in denen kirchliches Leben in Erscheinung tritt, desto größer wird auch die Relevanz kirchlicher Arbeit sein. Ortsgemeinden mit ihren traditionellen Formen, zu denen man meist Zugang findet, in dem man sich etwa Gemeindekreisen anschließt, werden sicher einen hohen Stellenwert behalten. Als ausschließliches Modell für eine Kirche der Zukunft taugt diese im Wesentlichen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammende Form kirchlicher Präsenz allerdings nicht. Und ein Finanzierungsmodell, das zukunftstauglich sein soll, muss dem Rechnung tragen.
Thomas Gunkel
Reformation in Goslar



500 Jahre Reformation. Langsam nähern sich die Feierlichkeiten ihrem Höhepunkt. Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers gegen den Ablasshandel. Es ist nur ein Symboldatum, gewiss, so wie vieles in diesem Zusammenhang symbolisch ist. Hat er die Thesen wirklich an die Tür der Schlosskirche genagelt? Und inwieweit trifft es denn zu, dass dadurch der Prozess losgetreten worden ist, der das Gesicht Deutschlands und Europas verändert hat? Vielerorts wird dem in diesem Jahr nachgegangen. Und Wittenberg ist sicher zu Recht die erste und wichtigste Anlaufstelle für die, die sich auf Spurensuche begeben wollen. Wer in Wittenberg aus dem Zug steigt, sieht als Erstes ein überdimensionales Buch, die Bibel, die sich bei näherem Betrachten als Aussichtsturm erweist. Auch das ist ein schönes Symbol: Die Bibel, die uns Überblick verschafft in dem Bemühen, unsere Leben zu deuten! Von der Aussichtsplattform aus sind Stadt- und Schlosskirche zu sehen. Der Weg dorthin ist gesäumt von hölzernen Toren. Sie erinnern an den sogenannten „Europäischen Stationenweg“, in den auch Goslar einbezogen war. Das Banner an einem der Tore zeigt den Namen Goslars in großen Lettern. Zu Recht, wie ich meine, denn auch in Goslar kann man auf Spurensuche gehen.
Die kann z. B. an der heute (wieder) katholischen Jakobikirche beginnen. Sie war im frühen 16. Jahrhundert die Kirche der Handwerker, eng verbunden mit den Gilden der Bäcker, der Schneider oder der Schuster. Sie drängten auf Veränderung sowohl der kirchlichen wie der politisch-sozialen Verhältnisse. So entstanden im Jahre 1525 im Umfeld der Jakobikirche die „Gravamina“, eine Liste von Beschwernissen oder Beschwerden. Zu den dort erhobenen Forderungen zählte das Recht, die Pfarrer selbst auswählen zu dürfen, die das Evangelium rein und lauter predigen sollten. Man forderte aber auch eine Art Nebenregiment neben dem Rat der Stadt. Denn dort hatten nur die Patrizier das Sagen. Viele Forderungen aus den Gravamina haben Wirtschaftliches zum Inhalt. Man lehnte sich offenbar an ähnliche Forderungen an, wie sie anderenorts bereits erhoben worden waren und den Hintergrund der Bauernaufstände bildeten, die den Süden Deutschlands bis hin nach Thüringen erschütterten. In Goslar zeichnete sich zudem eine Krise besonderer Art ab, denn der Braunschweiger Herzog wollte die Rechte am Erzbergbau im Rammelsberg zurück haben – eine Gefahr für die Stadt, die neben dem Handel vor allem von den Schätzen des Berges lebte. Es kam schließlich zum Konflikt, der Bergbau ruhte, hunderte von Bergknappen, die arbeitslos geworden waren, verließen die Stadt. Und natürlich ging es nun auch dem Rest der Bevölkerung schlechter, nicht zuletzt den Handwerkern. Es gab eine explosive Stimmung in der Stadt, die sich 1527 entlud. Die außerhalb der Stadtmauern gelegenen Klöster Georgenberg und Petersberg sowie die Kirchen im Bergdorf am Rammelsberg und zum Heiligen Grabe vor dem Vititor gingen in Flammen auf. War es Wut auf diejenigen Kleriker, die als altgläubig galten und Veränderungen ablehnten? Oder doch eine strategische Maßnahme, um dem Braunschweiger Herzog die Möglichkeit zu nehmen, sich unmittelbar vor den Toren der Stadt zu verschanzen? Der jedenfalls nutzte seine Chance und erhob Klage gegen Goslar vor dem Reichkammergericht: Landfriedensbruch.
Hier liegen die Wurzeln für die spätere Bündnispolitik des Rates. Eigentlich musste der Rat darauf bedacht sein, den Status der reichsfreien Stadt nicht zu gefährden, was damit gleichbedeutend war, auch den religiösen bzw. kirchenpolitischen Optionen des Kaisers zu folgen: keine Reformation! Dennoch blieb der Stadt am Ende nur das Bündnis mit dem evangelischen Schmalkaldischen Bund, der 1531 gegründet wurde. Wenig später trat auch Goslar bei.
Da waren die entscheidenden Weichen in Goslar aber bereits gestellt. Obwohl dem reformatorischen Bestreben eigentlich eher abgeneigt, ging es dem Rat darum, die Ordnung in der Stadt wieder herzustellen. Dazu musste der Rat dem Drängen auf Veränderungen nachgeben. 1527 bemühte sich die Stadt darum, Johannes Bugenhagen zu gewinnen, aber der Versuch scheiterte. Ein Jahr später kam dann Nikolaus von Amsdorf, ein Freund Martin Luthers, für drei Wochen in die Stadt. Der Magdeburger Superintendent entwarf eine neue Gottesdienstordnung, kittete notdürftig den Bruch zwischen dem Rat und der auf Veränderung drängenden Bevölkerung und setzte mit Johannes Amandus den ersten Goslarer Superintendenten ein. Es war indes kaum mehr als ein Auftakt für die Einführung der Reformation; kein Wunder: Hatte doch der Rat eher halbherzig zugestimmt.
1531 war Nikolaus von Amsdorf dann noch einmal in der Stadt und nun entstand eine umfassende neue, evangelische Kirchenordnung. Die Festigung der Reformation in der Stadt war dann nicht zuletzt das Werk von Eberhard Weidensee, dem dritten Superintendenten Goslars, der auf Johann Amandus und Paul von Rode folgte und durch von Amsdorf vermittelt worden war.
Die Niederlage des Schmalkaldischen Bundes in der Auseinandersetzung mit dem Kaiser vermochte dann nichts mehr daran zu ändern, dass Goslar eine evangelische Stadt geworden war.
Thomas Gunkel
500 Jahre Reformation

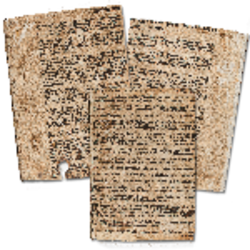
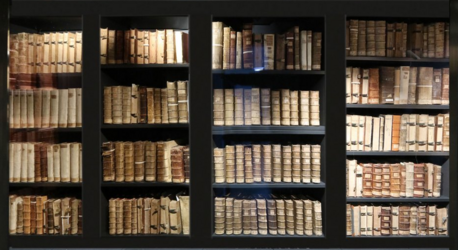
Am 31. Oktober 2016 begann offiziell das Reformationsjubiläum. Bei uns in Goslar haben wir diesen Anlass mit einem ökumenischen Gottesdienst begangen, in dem Pfarrer Dirk Jenssen von der katholischen Kirche Nordharz über Martin Luther gesprochen hat, während der lutherische Pfarrer Ralph Beims über Papst Franziskus sprach – ein gelungener Auftakt, steht für viele Menschen die Erinnerung an die Reformationsereignisse doch als Synonym für eine Kirchenspaltung. Umso wichtiger sind gemeinsam gefeierte Gottesdienste, damit deutlich wird, dass heute nicht so sehr das Trennende als vielmehr das Verbindende zwischen den Konfessionen im Vordergrund steht. Martin Luther, mit dessen Namen die Reformation auf‘s Engste verknüpft ist, wollte, dass Bibellektüre im Zentrum christlicher Praxis steht. Insofern entspricht es einem reformatorischen Anliegen, wenn Protestanten und Katholiken sich gemeinsam um das Wort Gottes versammeln.
Knapp einen Monat später folgte der zweite wichtige Akzent in den hiesigen Jubiläumsfeierlichkeiten. Denn Goslar hat Aufnahme gefunden in den sogenannten Europäischen Stationenweg. Am 1. Dezember machte der „Reformations-Truck“ auf dem Areal der ehemaligen Stiftskirche halt, vis-a-vis der Kaiserpfalz. Wir konnten an dem Tag unter anderem einen Film über die Reformationsereignisse in Goslar präsentieren (abrufbar unter luther2017-goslar.de). Außerdem zeigten wir erstmals die jüngst in der Marktkirchenbibliothek gefundenen Fragmente eines Plakates, das vor 500 Jahren auf den von Johann Tetzel vertriebenen Ablass hinwies – ein sensationeller Fund.
Wir sind also mittendrin in den Reformationsfeierlichkeiten. Bemerkenswert finde ich, dass keineswegs ausschließlich kirchliche Kreise sich für den 500. Jahrestag der Reformation interessieren. So ist es gelungen, ein kleines Booklet zu erstellen, in dem neben der evangelischen Kirche auch andere Kulturträger wie die beiden Goslarer Gymnasien, der Geschichtsverein und der Bund bildender Künstler ihr Veranstaltungsprogramm zum Reformationsjahr veröffentlichen. Das Booklet ist in den Kirchen, beim Stadtmarketing und an vielen anderen Orten erhältlich. Etliches davon spielt sich in Goslar selbst ab, aber auch im ländlichen Raum um Goslar gibt es entsprechende Veranstaltungen. So plant gegenwärtig ein Vorbereitungskreis ein Reformationsfestival, das 25. bis zum 27. August 2017 auf dem Gut in Altwallmoden stattfinden wird. Ein Chöretreffen, eine Art „Markt der Möglichkeiten“, ein Konzert der Gruppe Maybebop sowie ein propsteiweiter Festgottesdienst gehören zum Programm.
Ein besonderes Highlight im Reformationsjahr wird die Ausstellung in der Marktkirche sein. Sie geht dem Thema Freiheit und Bindung des Gewissens nach, dass spätestens seit Luthers Weigerung auf dem Reichstag zu Worms, seine Schriften zu widerrufen, von unabweisbarer Aktualität ist. Luther mochte es nicht den Bischöfen oder dem Papst überlassen, über Wahrheit und Irrtum zu entscheiden. Nur das, was durch Argumente aus der heiligen Schrift ihn in seinem Gewissen zwinge, könne für ihn ein Maßstab sein, so sagte er. Sicher müsste Luther heute mit vielen unserer Zeitgenossen darüber diskutieren, welche konkreten Inhalte für Gewissensentscheidungen maßgeblich sein sollen. Aber dass freie Menschen letztlich keine andere Instanz als die ihres Gewissens bei der Entscheidungsfindung gelten lassen können, gilt heute als allgemeine Überzeugung. Die Ausstellung, die am 14. Mai eröffnet wird, wird sich dem Thema von zwei Seiten nähern: Zum einen knüpfen wir an die Schätze der Marktkirchenbibliothek an und an die Gewissenskonflikte ihres ursprünglichen Besitzers Andreas Gronewald und seines Freundes, des Goslarer Superintendenten Eberhard Weidensee. Zum anderen werden junge Künstler und Künstlerinnen der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig Exponate unter dem Titel „Hier stehe ich und kann nicht anders“ zeigen.
Schauen Sie sich das erwähnte Booklet an und nehmen Sie an dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm teil. Es lohnt sich.
Thomas Gunkel
Israel und Palästina

Eigentlich kann ich nur meiner Ratlosigkeit Ausdruck geben angesichts der Bilder und Nachrichten aus Israel und nun auch aus dem Gazastreifen. Es fällt mir schwer, darüber zu schreiben, weil es kaum möglich ist, der Polarisierung zu entkommen.
Manche der Medien, die sonst wenig Zurückhaltung an den Tag legen, wenn spektakuläre und schockierende Bilder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, haben nach dem Angriff der Hamas auf Israel darauf verzichtet, die schlimmsten der Aufnahmen zu zeigen, die ihnen zur Verfügung standen. Es gibt ein Zuviel des Schreckens. Offenbar sind gezielt Kinder getötet worden. Ein Angriff auf eine Schule! Auch die Angriffe auf die Kibbuzim haben wohl nicht nur damit zu tun, dass sie zum Teil an den Gazastreifen angrenzen. Diese besonderen Orte gehörten einmal zur Gründungsidee des modernen Staates Israel. Hier stand und steht der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Und so ist es kein Zufall, dass besonders in einigen der Kibbuzim sich Israelis für die Verständigung mit den Palästinensern eingesetzt und sich kritisch zur Siedlungspolitik der Regierung bzw. der Ultraorthodoxen geäußert haben. Denn die macht eine Zwei-Staaten-Lösung und friedliche Koexistenz schwierig. Möglicherweise betrachtete die Hamas nicht die Hardliner in Israel als ihre ärgsten Gegner, sondern die, die auf Ausgleich und Versöhnung setzten. Friedensbemühungen sollen unmöglich gemacht werden.Daher der Angriff auf die Kinder.
Und der Plan scheint aufzugehen. Die Regierung Israels glaubt, dass die Hamas und ihre Unterstützer nur die Sprache der Waffen verstehen. Bis zu dem Tag, an dem ich diesen Artikel schreibe, wurde keine Waffenruhe vereinbart, nur Gefechtspausen für Fluchtkorridore. Alles andere werde die Hamas ausnutzen, meint die Regierung. Auch den Geiseln sei, wenn überhaupt, nur so zu helfen. Dabei dürfte klar sein, dass in den Kampfhandlungen die Unterscheidung zwischen den Hamas-Leuten und der Zivilbevölkerung, die zum Teil als Schutzschilde missbraucht werden, kaum gelingen kann.
Währenddessen wird die Auseinandersetzung über diesen Konflikt auch in Deutschland ausgetragen. Aus der Politik und auch aus Teilen der Zivilgesellschaft kommen Solidaritätsbekundungen mit Israel. Aber auf den Straßen dominieren die Demonstrationen, die das Leid im Gazastreifen zum Thema haben, nicht das der Opfer auf der Seite Israels. Ich frage mich: Inwieweit sind diese Demonstrationen durch Empathie gegenüber der leidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen inspiriert? Inwieweit rechtfertigen sie den Hamas-Terror? Und ich merke, dass die Frage mich mit mir selbst konfrontiert. Denn das Mitgefühl mit Opfern sollte unteilbar sein. Das gilt auch in Zeiten, in denen die Realität so polarisiert ist, dass jede Äußerung, auch ein solcher Artikel für die Kirchenseiten, darauf befragt wird, auf wessen Seite man eigentlich stehe. Der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, sagt, es gehe bei dem Angriff auf Israel „um nichts anderes als die Auslöschung der Juden.“ Und er wünscht sich – so berichtet die Goslarsche Zeitung – , dass hierzulande das alle begreifen, ohne die üblichen ‚Ja, aber…-Sätze‘. Und fügt dann selbst ein ‚Ja, aber …‘ an: Die israelische Siedlungspolitik, die so oft als Entschuldigungsgrund für die Hamas aufgerufen wird, halte er für falsch. Welches ‚Ja, aber…‘ ist also in Ordnung, welches nicht?
Ich stimme dem zu, wenn die Regierung in Berlin sagt, es gehöre zur ‚deutschen Staatsräson‘, uneingeschränkt solidarisch mit Israel zu sein. Der Begriff, seinerzeit eingeführt von Angela Merkel, mag verfehlt sein, bezeichnet er doch üblicherweise das berechtigte Eigeninteresse eines Staates – in diesem Fall also Deutschlands –, das nicht aufgegeben werden darf. Gemeint war natürlich etwas anderes. Der Holocaust, der Versuch der vollständigen Auslöschung der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus, hat uns ein bedrückendes Erbe hinterlassen. Dieses Erbe gleichsam ausschlagen zu wollen, mit Hinweis darauf, dass es ja frühere Generationen waren, nicht wir selbst, die dieses Unrecht zu verantworten hatten, ist keine Option. Gewiss ist Schuld nicht übertragbar auf Nachgeborene. Und doch haften wir für das, was unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern getan oder unterlassen haben. Solche Haftung kann nicht ungeschehen machen, was geschehen ist. Aber sie kann sich in der Verantwortung dafür ausdrücken, dass sich nicht wiederholt, was geschehen ist. Damals gab es für Juden und Jüdinnen kaum eine Möglichkeit, den Plänen der Nazis zu entkommen, auch, weil es keinen Staat Israel gab. Deshalb war die Gründung des Staates Israel eine logische und moralisch gebotene Konsequenz. Das Existenzrecht Israels infrage zu stellen oder auch nur zu relativieren, hieße deshalb, dem jüdischen Volk erneut das vorzuenthalten, was ihnen damals vorenthalten wurde. Israel gebührt die Solidarität Deutschlands. Das muss uns – unaufgebbar und insofern uneingeschränkt – eine Verpflichtung sein.
Ja, aber…Zur Haftung für die Gräuel, die ein, zwei oder drei Generationen vor uns geschehen sind, gehört auch die unaufgebbare Verpflichtung, dafür einzutreten, dass Menschenrechte gewahrt werden, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Wahrung der Menschenwürde. Das gilt auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich kann nicht beurteilen, ob es tatsächlich der einzige Weg ist, der Israel bleibt, die Hamas vollständig zu zerschlagen. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das gelingen kann. Aber es wäre ein Unrecht, Opfer unter der Zivilbevölkerung als unvermeidlichen Kollateralschaden abzutun. Die palästinensische Bevölkerung und die Hamas sind nicht identisch. Und es ist offensichtlich, dass die Drahtzieher des Anschlags auf Israel gegenüber der Bevölkerung, die sie zu schützen vorgeben, wenig Rücksicht nehmen. Das Leid auch auf der Seite der Palästinenser zu beklagen, muss möglich bleiben.
Zu der Ratlosigkeit, die die aktuelle Entwicklung auslöst, gehört, dass im Moment wohl niemand beschreiben kann, welcher Weg zum Frieden führen könnte. Selbst wenn es gelingt, die Hamas bzw. die, die sie unterstützen, so zu schwächen, dass auf absehbare Zeit ein solcher Angriff nicht mehr möglich ist, ist das ganz offensichtlich nicht die Lösung des Konflikts. Es gehört zum Kalkül der Angreifer, die Polarisierung voranzutreiben. Und das dürfte ihnen so oder so gelingen. Hass zu säen ist immer einfacher als Versöhnung zu stiften. Ein solches Ausmaß an Gewalt löst unvermeidlich so viel Trauer und Wut aus, dass Wege zum Frieden erst einmal versperrt sind. Aus warmen und sicheren Wohnzimmern dem mit Friedensappellen entgegentreten zu wollen, hätte meines Erachtens etwas Unangemessenes – denn es reklamiert moralische Überlegenheit, ohne die Bereitschaft, dafür etwas zu riskieren.
Ja, aber…Die jüdische und die christliche Religion teilen miteinander, dass sie nach Wegen gesucht haben, der Spirale von Gewalt und Gegengewalt, von Wut, Zorn und Hass, die noch größeren Hass wachrufen, zu entkommen. Die Rechtssatzung „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (z.B. 2. Mose 21,24), wird fälschlich meist als Rechtfertigung von Rachebedürfnissen angeführt. Der Sinn war aber gerade entgegengesetzt. Der Eskalation von Zorn und Gewalt sollte Einhalt geboten werden, indem die Vergeltung auf das Maß des erlittenen Unrechts begrenzt wurde. In der Bergpredigt nimmt der jüdische Rabbi Jesus von Nazareth dies auf und spitzt es zu: Besser als die Gegengewalt zu begrenzen wäre es, auf Vergeltung gänzlich zu verzichten. „Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.“ Die Vision, die darin steckt, bleibt gültig, gerade dann, wenn die Realität sie auszulöschen sucht.
Allerdings: Ein Patentrezept war der Weg Jesu nie. Die Ethik, die er in der Bergpredigt empfiehlt, bedarf des Kairos, des günstigen Moments, in dem auch das Gegenüber überzeugt wird und der Zorn verfliegt. Es vermag wohl niemand zu sagen, was es braucht, dass solche Momente Wirklichkeit werden. Wer vermag in dieser Situation zu sagen, was es dazu braucht? Und doch: Ob Zufall, glückliche Fügung oder Geschenk Gottes – wer könnte, wer wollte ausschließen, dass so etwas auch künftig geschehen kann? Dass Gott es schenken kann? An dieser Hoffnung festzuhalten, sind wir den leidenden Menschen in diesem Konflikt schuldig.
Thomas Gunkel




